Das deutsche Bildungssystem steht vor enormen Herausforderungen. Um Schulen zukunftsfähig zu machen und umfangreiche Investitionsprogramme zu ermöglichen, haben Bund und Länder eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen, insbesondere die Öffnung von Artikel 104c. Der Bund erhält dadurch die Möglichkeit, umfassend in die Bildungsinfrastruktur und Schulen zu investieren. Bisher waren solche Finanzhilfen stark eingeschränkt. Dies hat eine grundlegende Debatte über den Föderalismus in Deutschland und das Verhältnis zwischen Bund und Ländern ausgelöst. Eine finanzwissenschaftliche Analyse der Gesetzesänderung von Artikel 104c zeigt, dass die politische Entscheidung kritisch zu bewerten ist, da sie in den Kern des Bildungsföderalismus eingreift.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) wird modifiziert. Nach der Föderalismusreform 2017, die bereits zahlreiche Änderungen der Verfassung beinhaltete, haben sich Bund und Länder im Vermittlungsausschuss erneut auf Modifikationen bestehender grundgesetzlicher Bestimmungen geeinigt. Im Mittelpunkt steht die Öffnung des Art. 104c GG, der die Finanzhilfen des Bundes im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur regelt. Bis zur Einigung bildete sich eine politische Konfliktlinie zwischen Bund und Ländern heraus, da die Länder den Gesetzentwurf im Bundesrat ablehnten und an den Vermittlungsausschuss überwiesen. Diese Brisanz überrascht nicht, da es um zentrale föderale Grundsätze und das Verständnis der Rolle der Länder im bundesstaatlichen Gefüge ging.
Der deutsche Bildungsföderalismus: Eine Übersicht
Der deutsche Föderalismus findet im Bildungswesen einen vielfältigen Ausdruck. Seit der Föderalismusreform I im Jahr 2006 gilt Bildung als “Ländersache”, als einer der wichtigsten Kompetenzbereiche der Länder. Dies stimmt jedoch nur zum Teil, wenn die öffentliche Aufgabe Bildung nach gebietskörperschaftlichen Zuständigkeiten und Bildungsbereichen differenziert wird. Im föderalen System muss zwischen Entscheidungskompetenz, Ausführungskompetenz (Verwaltungskompetenz) und Finanzierungskompetenz unterschieden werden, die nicht derselben Gebietskörperschaftsebene obliegen müssen. Zudem ist das Bildungswesen ein abstrakter Oberbegriff, unter dem verschiedene öffentliche Aufgaben subsumiert werden können, von der frühkindlichen Elementarbildung über die Schul- bis hin zur akademischen Ausbildung.
Ausgangspunkt für die Frage nach den Zuständigkeiten sind drei grundlegende Artikel des Grundgesetzes:
- Art. 30 GG: Die Ausübung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung staatlicher Aufgaben ist Sache der Länder.
- Art. 70 GG: Den Ländern obliegt das Recht der Gesetzgebung (Gesetzgebungsgrundsatz).
- Art. 83 GG: Die Länder führen Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus (Ausführungsgrundsatz).
- Art. 104a GG: Bund und Länder tragen die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, gesondert (Finanzierungsgrundsatz).
Grundsätzlich weist das Grundgesetz den Ländern das Recht bzw. die Pflicht zu, Bildung gesetzgeberisch zu regeln sowie entsprechende Bildungsgesetze auszuführen und -aufgaben zu finanzieren. Abweichungen gibt es allerdings in allen drei Kompetenzbereichen.
Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung kann der Bund etwa bei Regelungen der Ausbildungsbeihilfen und der Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 13 GG) sowie bei solchen der Hochschulzulassung und -abschlüsse (ebenda, Nr. 33) von seinem Gesetzgebungsrecht Gebrauch machen. Bei letzterem haben die Länder nach Art. 72 Abs. 3 Nr. 6 GG das Recht, von einer Bundesregelung abzuweichen. Darüber hinaus lässt sich aus dem Grundgesetz ableiten, dass die frühkindliche Bildung (abgeleitet aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) sowie auch die betriebliche Berufsbildung – in Abgrenzung zur schulischen Berufsbildung – (ebenda, Nr. 11, 12) der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes obliegt.
Ausnahmen bei der Ausführungskompetenz ergeben sich auf der Grundlage von Art. 104a Abs. 3 GG. Wenn Länder Geldleistungsgesetze des Bundes ausführen, bei denen die Ausgaben mindestens zur Hälfte vom Bund getragen werden, handeln sie nicht in eigener Angelegenheit, sondern im Auftrag des Bundes. In solchen Fällen unterstehen die Länder den Weisungen des Bundes, der die Rechtmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit der Verwaltung beaufsichtigt. Im Bildungsbereich trifft dies konkret bei den Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu. Die Länder nehmen zwar auch hier die Aufgabenverwaltung wahr, unterliegen jedoch der Rechts- und Fachaufsicht des Bundes.
Überdies repräsentieren Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91b GG Ausnahmen in der Ausführungs- und darüber hinaus der Finanzierungskompetenz. Der Verfassungsartikel sieht vor, dass Bund und Länder bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre – soweit im konkreten Fall eine überregionale Bedeutung vorliegt – kooperieren können. Gleiches gilt für den internationalen Leistungsvergleich des Bildungssystems sowie diesbezügliche Berichte und Empfehlungen. Der Bund ist in der Regel an der Planung und Finanzierung dieser Aufgaben beteiligt. Wie die Gemeinschaftsaufgaben näher gestaltet werden, klären Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern, in denen auch geregelt ist, wer die Kosten trägt. In den Bereich des Art. 91b GG fallen beispielsweise Initiativen wie die gemeinsame Exzellenzstrategie zur Förderung der Spitzenforschung an Universitäten oder der Hochschulpakt 2020 zur gemeinsamen Sicherstellung eines Studienangebots, das dem hohen Studierendenaufkommen gerecht wird.
Eine weitere Ausnahme vom grundgesetzlichen Finanzierungsgrundsatz stellen Finanzhilfen des Bundes dar, die verfassungsseitig durch die (bereits bestehenden) Art. 104b und 104c GG fundiert werden. Im bildungspolitischen Zusammenhang ist insbesondere Art. 104c GG, der mit der Föderalismusreform 2017 eingeführt wurde, von weitreichender Bedeutung. Er ermöglicht es dem Bund, den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur – d. h. für Investitionen in die Ausstattung von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie Einrichtungen der Kinderbetreuung –, zu gewähren und lockert mithin das 2006 eingeführte Kooperationsverbot im Bildungsbereich. In diesem Zusammenhang ist Art. 104b Abs. 2 und 3 GG anzuwenden, d. h., nähere Bestimmungen sind in einem zustimmungspflichtigen Bundesgesetz oder einer Verwaltungsvereinbarung zu regeln. Die Mittel sind befristet und im Volumen degressiv auszugestalten und dem Bund werden weitreichende Kontroll- und Erhebungsrechte eingeräumt. Der sich hieraus ergebende Konkretisierungsauftrag des Grundgesetzes wurde 2017 erfüllt, indem das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz geändert und der Kommunalinvestitionsförderungsfonds um zusätzliche 3,5 Mrd. Euro aufgestockt wurde.
Neben den genannten Bestimmungen, die das GG für das Verhältnis von Bund und Ländern kodifiziert, sind die in den Schulgesetzen der Länder geregelten Kompetenzverteilungen zwischen der Landes- und der Gemeindeebene eminent wichtig, um den deutschen Bildungsföderalismus tiefer zu verstehen. Als verfassungsrechtlicher Bestandteil der Länder nehmen die Gemeinden und Gemeindeverbände eine herausragende Rolle in der Bildungspolitik ein. Die landesinterne Verteilung der Bildungsaufgaben in Deutschland ist heterogen und spiegelt die unterschiedlichen Kommunalisierungsgrade der einzelnen Länder wider. In der Regel gilt jedoch: Die Landesebene ist für die inhaltliche und strukturelle Gestaltung sowie weitgehend die personelle Ausstattung des Bildungswesens zuständig. Kommunen und Landkreise obliegt die Raum- und Sachausstattung von Schulen einschließlich der schulischen Sportstätten. Zudem hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt der Begriff der „kommunalen Bildungslandschaft“ etabliert, der die Verantwortung der Kommunen weit über die Bereitstellung der Schulinfrastruktur hinaushebt. Auf den Bund entfallen im Status quo nur rund 8 % der gesamtstaatlichen Bildungsausgaben, während die Länder rund 71 % und die Gemeinden rund 21 % repräsentieren.
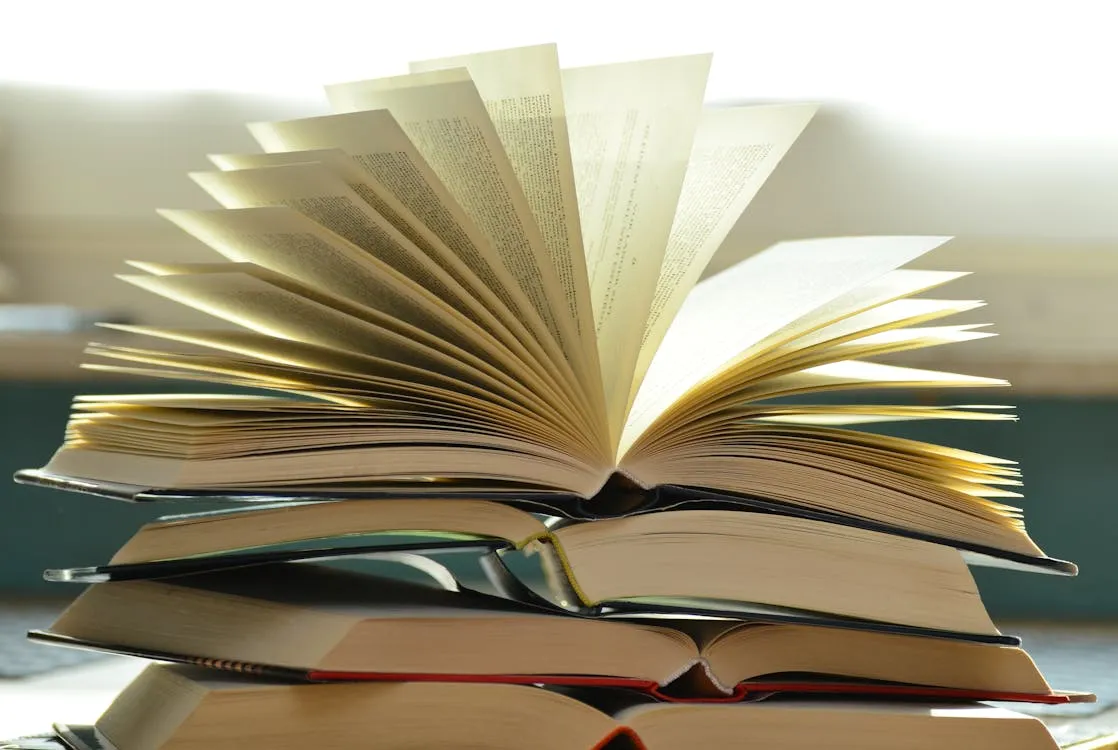 Eine Nahaufnahme von Büchern und Lernmaterialien, die die Bedeutung von Bildung und Wissen hervorheben.
Eine Nahaufnahme von Büchern und Lernmaterialien, die die Bedeutung von Bildung und Wissen hervorheben.
Die beschlossene Änderung des Status quo im Bildungsföderalismus
Nachdem der Bundesrat einen Gesetzentwurf des Bundes einstimmig abgelehnt und an den Vermittlungsausschuss überwiesen hatte, konnte dieser am 20.2.2019 einen Kompromiss erzielen und dem Deutschen Bundestag zum Beschluss empfehlen. Am Folgetag wurde diese Beschlussempfehlung von einer breiten Mehrheit des deutschen Bundestages angenommen. Die Zustimmung des Bundesrates wird in dessen Sitzung am 15.3.2019 erwartet.
Zwei der ausgehandelten Grundgesetzänderungen sind für den deutschen Bildungsföderalismus besonders relevant:
- Änderung des Art. 104b GG: Einfügung der Pflicht, Finanzhilfen des Bundes durch Landesmittel zu ergänzen (Kofinanzierungspflicht).
- Änderung des Art. 104c GG: Aufhebung der bestehenden Begrenzung der Finanzhilfen des Bundes für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur auf finanzschwache Gemeinden und Erweiterung der förderfähigen Tatbestände um besondere, mit diesen Investitionen unmittelbar verbundene, befristete Ausgaben der Länder und Gemeinden. Durch die Änderung werden neben Investitionen somit auch andere Ausgaben förderfähig sowie der Empfängerkreis auf Länder und nicht-finanzschwache Gemeinden erweitert. Darüber hinaus wird der Wirkungskontext der Finanzhilfen konkretisiert und die Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur ausdrücklich als Ziel verankert.
Die in Art. 104b GG neu implementierte Kofinanzierungspflicht der Länder wird auch hier angewendet; nicht jedoch die Sätze 4 und 7 des neuen Abs. 2. Das bedeutet, dass im Zusammenhang mit den Bundesfinanzhilfen im kommunalen Bildungsbereich die Kontrollrechte des Bundes nur eingeschränkt gelten und die Pflicht zur degressiven Ausgestaltung der Mittel entfällt. Ziel der Änderungen ist „die Erweiterung der Möglichkeiten des Bundes, die Länder und Kommunen bei ihren Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur, insbesondere zur Gewährleistung eines flächendeckenden Ganztagsschul- und Betreuungsangebotes und zur Bewältigung der Anforderungen der Digitalisierung an die Ausstattung und Vernetzung der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen“ zu unterstützen. Im Zentrum der begleitenden Debatte stehen insbesondere zwei Faktoren:
- Zum einen, dass die Möglichkeit von Bundesfinanzhilfen im Bereich der Schulausstattung in erheblicher Weise ausgedehnt wird und mithin auch ein steigender Bundeseinfluss im Bildungswesen erwartet werden kann. Dies erreicht im Vergleich zum Status quo unter anderem dadurch eine neue Qualität, dass die Förderfähigkeit auf nicht-investive Ausgaben erweitert wird. Im Rahmen des Art. 104c GG könnten demnach künftig auch Personal oder die Entwicklung gemeinsamer Bildungsstandards mit Finanzhilfen des Bundes teilfinanziert werden, wenn sie einen Zusammenhang mit dem Investitionszweck aufweisen. Dass der Bund entsprechend auch an Steuerungsmöglichkeiten und Kontrollrechten gegenüber den Ländern gewinnt, ist naheliegend und durch die weitgehende Anwendung von Art. 104b Abs. 2 und 3 GG grundgesetzlich angelegt. Ein weiter interpretatorischer Raum ist überdies dem neu eingefügten Passus „Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur“ inhärent, der als Ziel und zugleich als Rechtfertigung der Bundesfinanzhilfen im Rahmen von Art. 104c GG zu deuten ist. Dieser bleibt jedoch mit Blick auf die weitere inhaltliche Ausgestaltung vage und erscheint folglich dehnbar – wenngleich der Passus durch den Vermittlungsausschuss bereits abgemildert wurde.
- Zum anderen ist die Kofinanzierungspflicht der Länder umstritten. Diese soll sicherstellen, „dass künftige Finanzhilfen des Bundes im jeweils geförderten Investitionsbereich additiv zu den Investitionen des Landes wirken und Bundesmittel nicht lediglich die eigenen Investitionen der Länder ersetzen.“ Die Kofinanzierungsregel könnte – so die Argumentation ihrer Gegner – neue Abhängigkeiten in der Haushaltspolitik der Länder mit sich bringen, da die Bereitstellung eigener Mittel zur grundgesetzlichen Bedingung erhoben wird, um Finanzhilfen des Bundes für die kommunale Bildungsinfrastruktur zu erhalten. Zwar ist es den Ländern im Vermittlungsausschuss gelungen, den Bund auch in diesem (erheblich umstrittenen) Punkt zu einem Zugeständnis zu bewegen; die frühere Gesetzentwurfsfassung sah zunächst eine Ergänzung der Bundesfinanzhilfen durch Landesmittel in mindestens gleicher Höhe vor. Auch wenn nun keine konkrete Kofinanzierungsquote ins Grundgesetz aufgenommen wird, dürfte die Skepsis der Länder am Anlegen „Goldener Zügel“ im Bildungsbereich aus grundsätzlichen Erwägungen erhalten bleiben und lediglich dem Einigungsdruck untergeordnet worden sein. Zwar haben die Länder naturgemäß Interesse an einer finanziellen Unterstützung, sie präferieren es aber, ihre Finanzausstattung mit originären Steuermitteln oder ungebundenen Zuweisungen ohne fachaufsichtliche Einflussmöglichkeiten des Bundes zu verbessern.
Bewertung des Bildungsföderalismus nach finanzwissenschaftlichen Kriterien
Die Änderung des Art. 104c GG wird seit der Vorlage des ersten Gesetzentwurfs in Politik und Wissenschaft kontrovers diskutiert. Zentrale Bewertungsmaßstäbe stammen überwiegend aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive. Ökonomische Bewertungskriterien finden in der aktuellen Debatte hingegen weniger Beachtung. Dabei bietet insbesondere die ökonomische Theorie des Föderalismus einige bedeutende Ansätze, die in die Beurteilung der beschlossenen Grundgesetzänderung einfließen sollten. Das Theoriegerüst stellt die Frage, welcher Grad an Zentralität bei Bürgern mit hoher Mobilität und heterogenen Präferenzen zu einer möglichst effizienten Erfüllung staatlicher Aufgaben führt.
Bildung fällt erkennbar nicht in die Kategorie von Aufgaben mit Distributions- oder Stabilisierungsfunktion. Für sie stehen allokative Entscheidungskriterien stärker im Fokus. Zu diesen Kriterien zählen:
- ein auf die individuellen Präferenzen der Bürger abgestimmtes Angebot,
- die Förderung von Innovationsfähigkeit,
- die Übereinstimmung von Kosten- und Nutzenträgerkreisen sowie
- produktionstechnische Aspekte.
Gemessen an den Kriterien Präferenzadäquanz des Angebots und Förderung der Innovationsfähigkeit muss jede Zentralisierung des Bildungssystems mit Vorbehalten verbunden sein. Ein Kernkriterium der ökonomischen Föderalismustheorie ist zudem die Übereinstimmung von Kosten- und Nutzenträgerkreisen, die fiskalische Äquivalenz.
Wenn man bildungspolitische Kompetenzentscheidungen anhand des Kriteriums der fiskalischen Äquivalenz bewertet, ist zunächst die Reichweite des Nutzens zu betrachten, der von einer Bildungseinrichtung oder -maßnahme ausgeht. Der Nutzen, den Bildung stiftet, beschränkt sich nicht auf die unmittelbaren Bildungsempfänger allein. Da die dezentrale Bereitstellung von Bildungsleistungen positive externe Effekte für andere Gebietskörperschaften und deren Bürger erzeugt, verlangt das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz mithin, die aus Bildungsleistungen resultierenden externen Effekte zu internalisieren, indem die am Nutzen partizipierenden Gebietskörperschaften entsprechend ihres Nutzenanteils auch an der Finanzierung beteiligt werden.
Da dies weder mit der Freizügigkeit der Einwohner noch mit dem föderalen Steuersystem Deutschlands vereinbar ist, erscheint eine punktuelle Zentralisierung der Finanzierungskompetenz in Form einer (stärkeren) Beteiligung des Bundes an der Bildungsfinanzierung auch unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung und geringer werdender Ortsgebundenheit durchaus sinnvoll.
Bedeutung des Konnexitätsprinzips im Bildungsföderalismus
Flankiert wird dieses durch ein weiteres finanzwissenschaftliches Kernprinzip: das Konnexitätsprinzip. Es verknüpft die Finanzierungskompetenz mit der Wahrnehmung einer Aufgabe. In Deutschland gilt in diesen Fällen zwischen Bund und Ländern grundsätzlich eine Ausführungskonnexität, die aus Art. 104a Abs. 1 GG abgeleitet und dann angewendet wird, wenn die Länder – dies ist der Regelfall – Aufgaben in eigener Angelegenheit wahrnehmen. Hierbei folgt die Finanzierungskompetenz der Ausführungskompetenz. Von der Ausführungskonnexität zu differenzieren ist die Entscheidungskonnexität, bei der die Finanzierung an die Gesetzgebung und folglich an die Entscheidungskompetenz gekoppelt ist, was im Bildungsbereich bisher eine Ausnahme darstellt.
Die Kompetenzentflechtung durch die Föderalismusreform 2006 führte dazu, dass Fragen zur Konnexität im Bildungsbereich nunmehr – von einigen Ausnahmen abgesehen – im Verhältnis zwischen den Ländern und ihren jeweiligen kommunalen Ebenen zu behandeln waren. Im konkreten Bezug auf die Schulen ist erst 2017 mit der Einführung des Art. 104c GG eine abweichende Regelung geschaffen worden. Die darin geregelten Finanzhilfen des Bundes bei der kommunalen Bildungsinfrastruktur bedeuten de facto, dass die Finanzierung anteilig auf den Bund übergegangen ist.
Mit der nun beschlossenen Öffnung des Artikels wird dieser Ausnahmecharakter zunehmend aufgegeben. Steigt neben der Finanzierungsverantwortung des Bundes wie erwartet auch dessen Gestaltungseinfluss im Bildungsbereich, folgt dies dem Prinzip der Entscheidungskonnexität und macht die Regelabweichung im Rahmen des Art. 104c GG bedeutender. Wird zunehmend von der verfassungsrechtlichen Grundregel der Ausführungskonnexität durch die Öffnung des Art. 104c GG abgewichen, ist damit kein prinzipielles Risiko verbunden. Vielmehr liegt ein solches darin, dass Entscheidungs- und Ausführungskompetenz im Bildungsbereich staatsorganisatorisch dort wieder stärker auseinanderfallen könnten, wo sie durch die Föderalismusreform I von 2006 in Übereinstimmung gebracht wurden und der Zielkonflikt zwischen Entscheidungs- und Ausführungskonnexität folglich gar nicht besteht.
Aus einem erneuten Auseinanderfallen von Entscheidungs- und Ausführungskompetenz folgt, dass insbesondere Wirtschaftlichkeitsanreize der ausführenden Gebietskörperschaftsebene bei der Aufgabenerfüllung im Vergleich zum Status quo vernachlässigt werden könnten. Zwar wirkt die miteingeführte Kofinanzierungspflicht diesem Risiko entgegen.
Als viertes allokatives Kriterium sind produktionstechnische Aspekte zu bewerten. Es ist jedoch fraglich, ob für schulische Sachinvestitionen Skalenvorteile bzw. Standardisierungsvorteile realisierbar sind und subsidiäre Vorteile generieren könnten. Produktionstechnische Erwägungen sprechen daher eher gegen eine weitere Zentralisierung im Bildungsbereich.
Fazit zum Bildungsföderalismus in Deutschland
Große Investitionsoffensiven im Bereich der Schulen sind angesichts bestehender Zustände und absehbarer Herausforderungen dringend erforderlich. Diskussionswürdig war jedoch der Weg, den die Bundesregierung beschritten hatte, um die geplanten Investitionen zu realisieren: die Änderung des Grundgesetzes im Art. 104c.
Letztlich bleibt die vielfach kritisierte Verfassungsänderung bestehen: mit dem Resultat, dass sich der Bund im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur wesentlich stärker als bisher engagieren darf – finanziell und in Teilen auch inhaltlich.
Gemessen an den hier herangezogenen finanzwissenschaftlichen Kriterien ist diese Entscheidung von Bund und Ländern nicht ausnahmslos, jedoch überwiegend kritisch zu bewerten. Positiv zu beurteilen ist eine größere Einbindung des Bundes in die öffentliche Aufgabe Bildung lediglich unter dem Gesichtspunkt der fiskalischen Äquivalenz. Alle weiteren hier betrachteten Kriterien lassen sich hingegen eher als Begründung für die dezentrale Ansiedlung von bildungsbezogenen Aufgabenkompetenzen anführen. Die beschlossene Änderung des Art. 104c GG steht dazu im Widerspruch. Der Bildungsföderalismus in Deutschland wird durch diese Änderung maßgeblich beeinflusst und bedarf weiterer Beobachtung.
