Emanzipatorische Bildung zielt darauf ab, Menschen in die Lage zu versetzen, sich von Unterdrückung und Abhängigkeit zu befreien und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dieser Ansatz ist besonders relevant angesichts aktueller Herausforderungen wie Globalisierung, Individualisierung und Digitalisierung.
Die Definition von Emanzipation nach Oskar Negt umfasst die „Überwindung eines Zustands von Herrschaft und Abhängigkeit; Freisetzung nicht-manipulierter Bedürfnisse und Abschaffung von Unterdrückung, Unterordnung; Auflösung von Vorurteilen; Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung.“ (Negt 1974, 125).
In der deutschen Politikdidaktik der 1960er-Jahre rückten „Konflikt, Kritik und die Auseinandersetzung mit politischen Streitfragen in den Vordergrund der Bildungsarbeit“ (Gagel 2002, 15). Politische Bildung sollte zur Gesellschaftskritik und Emanzipation beitragen. Protagonisten dieser didaktischen Wende“ waren u.a. Kurt Gerhard Fischer, Wolfgang Hilligen und Hermann Giesecke. Die außerschulische Politische Jugendbildung versuchte, Ziele wie Selbstbestimmung, Selbstorganisation und „praxisorientiertes kollektives Lernen“ (Damm 1977, 37) in selbstverwalteten Jugendzentren zu verwirklichen.
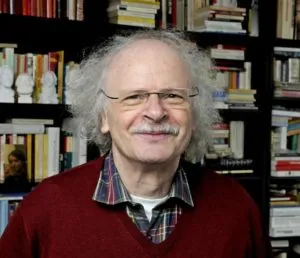 Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, Experte für politische Bildung
Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, Experte für politische Bildung
Identische Zielvorstellungen finden sich in der Politischen Erwachsenenbildung. Ihre Bildungsangebote sollen individuelle und kollektive Emanzipationsprozesse sowie gesellschaftliche Veränderungen ermöglichen. Dafür wurden charakteristische politisch-pädagogische Ansätze entwickelt: Teilnehmendenorientierung, Parteinahme/Parteilichkeit, Handlungsorientierung/politische Aktivierung/Mobilisierung, Stadtteilarbeit und Zielgruppenarbeit. Diese Ansätze sind weiterhin relevant, müssen jedoch an die veränderten Bedingungen der heutigen Gesellschaft angepasst werden.
Herausforderungen für emanzipatorische Bildung im 21. Jahrhundert
Emanzipation ist nach wie vor eine zentrale Zielvorstellung der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung (siehe Hufer, Oeftering, Oppermann 2021, 255). Angesichts der Megatrends Globalisierung, Individualisierung und Digitalisierung stellen sich jedoch neue Herausforderungen für emanzipatorische politische Bildung.
Globalisierung und ihre Auswirkungen
Die Globalisierung hat zu einer zunehmenden Vernetzung der Welt geführt, birgt aber auch Risiken wie wachsende Ungleichheit und den Verlust lokaler Identitäten. Emanzipatorische Bildung muss daher globale Zusammenhänge aufzeigen und gleichzeitig die Bedeutung regionaler und lokaler Besonderheiten betonen.
Individualisierung und der Verlust des Gemeinsinns
Die zunehmende Individualisierung kann zu einem Verlust des Gemeinsinns und der Solidarität führen. Emanzipatorische Bildung sollte daher die Bedeutung von Gemeinschaft und sozialem Engagement hervorheben und Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben aufzeigen.
Digitalisierung und die Informationsflut
Die Digitalisierung hat zu einer Informationsflut geführt, die es Einzelnen schwer macht, relevante Informationen zu finden und zu bewerten. Emanzipatorische Bildung muss daher Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien vermitteln und zur kritischen Auseinandersetzung mit Informationen anregen. Dies umfasst auch die Fähigkeit, Fake News und Desinformation zu erkennen und zu widerlegen.
Ansätze für eine zeitgemäße emanzipatorische Bildung
Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, bedarf es neuer Ansätze in der emanzipatorischen Bildung.
Förderung von Medienkompetenz
Die Vermittlung von Medienkompetenz ist essenziell, um Menschen in die Lage zu versetzen, sich kritisch mit Informationen auseinanderzusetzen und die Chancen und Risiken der digitalen Welt zu nutzen. Dazu gehört auch die Förderung des kritischen Denkens und der Fähigkeit zur Problemlösung.
Stärkung des gesellschaftlichen Engagements
Emanzipatorische Bildung sollte Menschen dazu ermutigen, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Dies kann durch die Unterstützung von Bürgerinitiativen, die Förderung des Ehrenamts und die Stärkung der politischen Partizipation geschehen.
Förderung des interkulturellen Dialogs
Angesichts der zunehmenden Vielfalt in der Gesellschaft ist die Förderung des interkulturellen Dialogs von großer Bedeutung. Emanzipatorische Bildung sollte daher zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen anregen und Vorurteile abbauen. Dies kann durch den Austausch mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, die Organisation von interkulturellen Projekten und die Vermittlung von Wissen über verschiedene Kulturen geschehen.
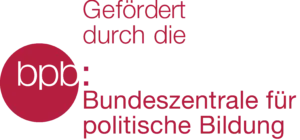 Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung
Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung
Fazit
Emanzipatorische Bildung ist ein wichtiger Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Bewältigung aktueller Herausforderungen. Durch die Förderung von Medienkompetenz, die Stärkung des gesellschaftlichen Engagements und die Förderung des interkulturellen Dialogs kann emanzipatorische Bildung dazu beitragen, eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft zu schaffen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, emanzipatorische Bildung in allen Bereichen des Bildungssystems zu verankern und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Weiterlesen:
- Damm, Diethelm (1977): Politische Jugendarbeit: Grundlagen, Methoden, Projekte, 2. Aufl., München 1977.
- Gagel, Walter (2002): Der lange Weg zur demokratischen Schulkultur. Politische Bildung in den fünfziger und sechziger Jahren, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 45, S. 6 –16.
- Hufer, Klaus-Peter/Oeftering, Tonio, Oppermann, Julia (2021): Positionen der Politischen Bildung 3. Interviews zur außerschulischen Jugend- und zur Erwachsenenbildung, Schwalbach/Ts.
- Negt, Oskar (1975): Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen, 5. Aufl., Frankfurt/M. u. Köln
