Sally Rooneys „Normale Menschen Roman“ hat die Literaturwelt im Sturm erobert und wird sowohl von Kritikern als auch von Lesern enthusiastisch gefeiert. Das Werk, das nach ihrem erfolgreichen Debüt „Gespräche unter Freunden“ erschien, taucht tief in die komplexen emotionalen und sozialen Dynamiken zweier junger Menschen ein. Der Roman erzählt die Geschichte von Marianne und Connell, deren Wege sich in einem kleinen irischen Provinzstädtchen kreuzen und deren Beziehung sich über mehrere Jahre hinweg entfaltet.
Marianne, die Tochter einer Anwältin, und Connell, der Sohn einer Putzfrau, deren Mutter für Mariannes Mutter arbeitet, besuchen dieselbe Oberschule. Beide sind intellektuell begabt und erfolgreich, doch ihre soziale Stellung könnte unterschiedlicher nicht sein. In der Schulzeit ist Connell der Star – gut aussehend, umgänglich, intelligent und ein talentierter Fußballspieler. Marianne hingegen gilt als Außenseiterin, verschlossen und unscheinbar, die in den Pausen lieber Prousts „Auf dem Weg zu Swann“ liest als sich ins Getümmel zu stürzen. Sie selbst bezeichnet sich später rückblickend als „hässliche Loserin“. Trotz dieser scheinbaren Diskrepanz beginnen sie eine geheime Beziehung, die sie vor ihren Mitschülern verbergen. Dieses Geheimnis verleiht ihrer Sexualität eine besondere Intensität und Spannung, die die üblichen Teenie-Liebschaften in den Hintergrund rückt. Rooney beschreibt Mariannes Empfinden, wie das Geheimnis „angenehm schwer in ihrem Körper“ wiegt, während Connell es „wie etwas Großes und Heißes mit sich herumträgt“.
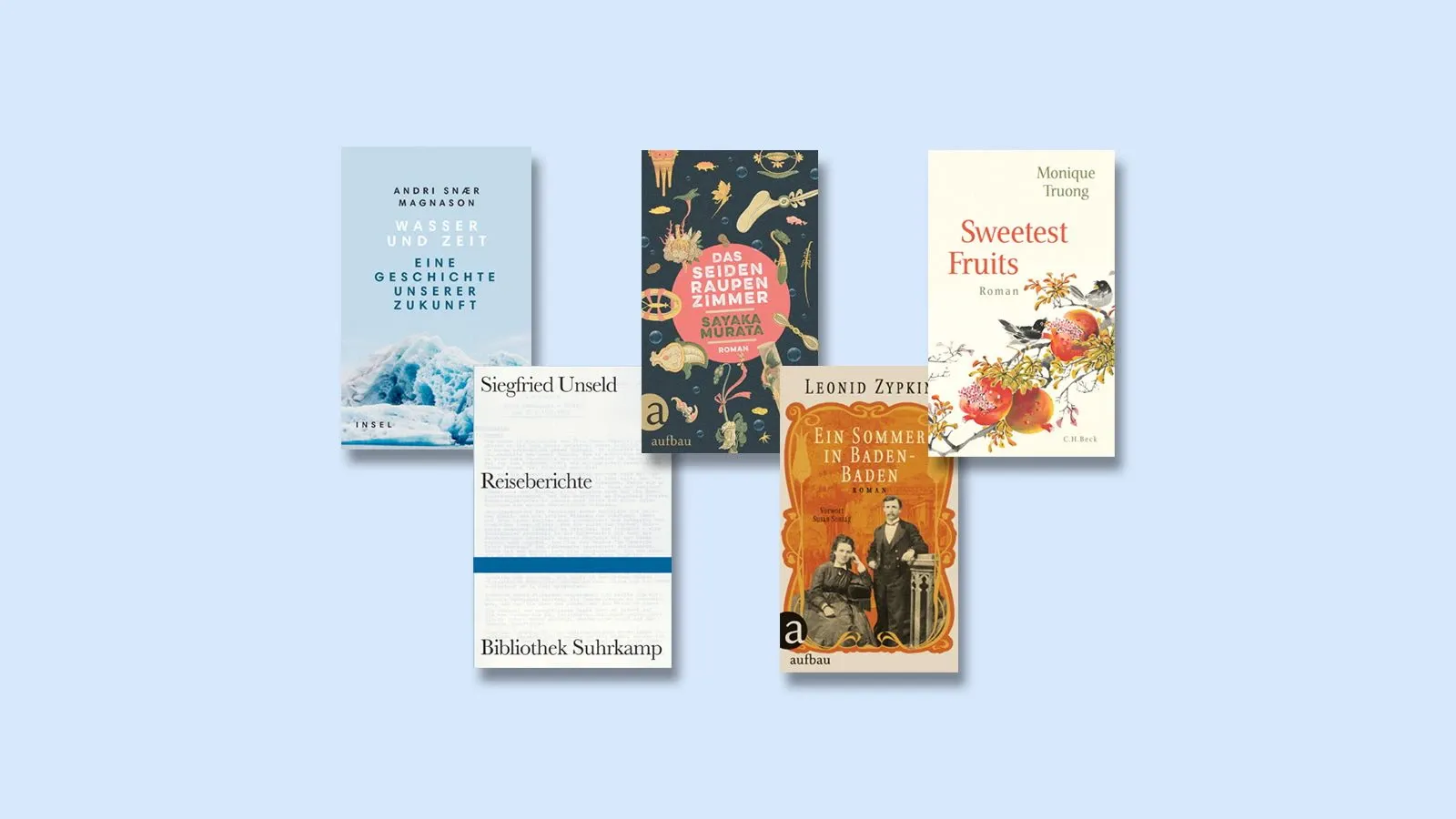 Marianne und Connell, die Hauptfiguren aus Sally Rooneys Roman „Normale Menschen“, in einer nachdenklichen Interaktion
Marianne und Connell, die Hauptfiguren aus Sally Rooneys Roman „Normale Menschen“, in einer nachdenklichen Interaktion
Die Schichten einer komplexen Beziehung
„Normale Menschen“ ist wuchtiger und direkter als Rooneys Erstling und wirkt zugleich klassischer, stärker der Tradition verpflichtet. Unter der präzise gezeichneten sozialen und psychologischen Anordnung schimmert das Modell englischer Romane des 19. Jahrhunderts durch: Gefühl und Vorurteil im Widerstreit, Seelenlage und Klassenlage in handlungstreibender Disharmonie, alles aus einer unverkennbar weiblichen Perspektive. Die Wahl eines George-Eliot-Zitats als Motto des Buches ist hier ein treffendes Signal.
Im Mikrokosmos der Schule ist Connell zunächst der Stärkere. Eine tiefe Verletzung entsteht, als er Marianne nicht zum Abschlussball einlädt, was dazu führt, dass sie dem Ereignis fernbleibt. Das vermeintliche Geheimnis, das sich später als keines mehr erweist, wird zum Gefängnis. Hier könnte die Geschichte enden, wenn gesellschaftliche Gegensätze greifen würden – Connell würde einen praktischen Beruf anstreben und in der Nähe Jura studieren. Doch Marianne, die Proust-Leserin, geht für Literatur ans Trinity College in Dublin und überredet Connell, ihr zu folgen.
Der Wandel der sozialen Dynamik und die Suche nach Identität
Am Trinity College verschiebt sich das Gefüge von Klassenlage und sozialem Ansehen dramatisch. Marianne wird elegant, ihre Herkunft wird nun zu kulturellem und sozialem Kapital. Connell hingegen fühlt sich als ungeschicktes „Landei“ in billigen Klamotten fehl am Platz. Rooney macht aus der Klassenfrage kein übermäßig großes Thema; im Kern ist ihr normale menschen roman eine Beziehungsgeschichte, die ihre Wurzeln in tiefen persönlichen Verletzungen findet. Dennoch lässt sie die objektiven gesellschaftlichen Umstände konstant mitschwingen. Der mittellose Connell muss als Kellner jobben, bevor ein Stipendium ihm finanzielle Freiheit verschafft. Auch Marianne bewirbt sich erfolgreich um ein Stipendium, nutzt es jedoch, um ein brüchiges Selbstbewusstsein zu reparieren.
Wenn die beiden Protagonisten in der Studentenzeit ihre gemeinsame Wohnung einrichten müssten, würden sie sicherlich überlegen, ob eine praktische küchenzeile mit elektrogeräten und geschirrspüler sofort lieferbar eine gute Investition wäre. Solche alltäglichen Überlegungen spiegeln die Realität ihres jungen Erwachsenenlebens wider, in dem finanzielle Entscheidungen eine Rolle spielen, auch wenn die emotionalen Turbulenzen im Vordergrund stehen.
Im 19. Jahrhundert würden die komplexen Gefühls- und Klassenlagen der beiden wohl auf eine – womöglich scheiternde – Ehe zulaufen. Doch die Gegenwart, in der das Buch spielt (zwischen 2011 und 2015), bietet diesen institutionellen Parameter nicht mehr. Die beiden sind auf die Liebe als Kommunikation zurückgeworfen, ein tägliches, fluides Reden und Befragen, immer im Kontext ihrer Umgebung – Mütter, Freundinnen, Kommilitonen –, deren Beobachtungen oft unbarmherzig und falsch sind. Man könnte sich vorstellen, wie sie bei der Suche nach ihrer ersten gemeinsamen Unterkunft überlegen, ob eine einbauküche mit geräten zu ihrem Budget passt oder ob sie lieber auf Angebote wie roller küchen 50 rabatt warten sollten.
Liebe als Kommunikation und die Kunst der Unverbindlichkeit
Eigentlich müssten Marianne und Connell, nachdem sie ihre Außenseiterrollen und materiellen Nöte überwunden haben, harmonisch zueinanderfinden. Alle Versuche mit anderen Partnern zeigen, dass sie voneinander nicht lassen können. Und wie oft sagen sie einander, dass sie sich lieben! Doch diese Liebesbekundungen wirken stets wie dahingesagt und werden sogleich in Frage gestellt: „Wir waren nie richtig zusammen.“ Dieses Wogen der Aussagen, der wechselseitigen Beschreibungen, der immer neuen Anläufe zu Verbindlichkeit ist der eigentliche Inhalt des Romans. Ihr Beziehungsstatus bleibt unklar. Man muss reden und es immer wieder mit Sex versuchen.
Die Darstellung der Charaktere erfolgt überwiegend von außen. Rooney zeigt ihre Figuren hauptsächlich beim Reden und gleichzeitigen „Etwastun“: kleine Tätigkeiten wie Schokocreme essen, einen Tisch decken oder einen Drink holen. Diese Handlungen sind so unspektakulär und fern jeglicher Poetisierung des Alltags, dass sich gelegentlich Langeweile einstellen kann. Es ist ein visuelles Nähesignal, eine Handkamera, die nah an den Figuren bleibt, ohne jedoch viel über ihr Aussehen zu verraten. Dies erklärt, warum „Normal People“ auch eine perfekte Vorlage für eine Verfilmung mit guten Schauspielern ist; die BBC-Serie hat das Buch in der öffentlichen Wahrnehmung bereits überholt. Die Figuren kennen und verstehen sich selbst nicht vollständig. Sie sind sehr jung, zwischen 17 und 22 Jahren alt, und alles, was sie tun und erfahren, machen sie zum ersten Mal. Sie irren sich, machen Fehler, verletzen sich und verpassen einander, weil sie sich missverstehen.
Die materielle Sicherheit spielt für beide eine Rolle, auch wenn sie unterschiedlich damit umgehen. Connell, der seinen Weg als Schriftsteller sucht, sehnt sich nach Stabilität, die eine küche mit geräten in den eigenen vier Wänden symbolisieren könnte. Für Marianne hingegen, die ihre inneren Kämpfe austrägt, ist der physische Raum oft sekundär, aber nicht unwichtig.
Innerlichkeit versus äußere Wahrnehmung
Daraus ließe sich ein gewichtiger Einwand entwickeln: Rooney nähert sich einer möglichen filmischen Umsetzung an, indem sie Physiognomien nicht festlegt, sondern Gesten betont. Ein erzählendes Drehbuch also, das die eigentliche Chance von Literatur – die Introspektion – verschenkt? Nichts von proustischem Drehen und Wenden seelischer Zustände, keine psychologischen Exkurse à la George Eliot. Die Erzählerinstanz ist im Roman zwar übergeordnet und durch Metaphern ausgewiesen, doch die psychologische Zurückhaltung bleibt.
Diese Undeutlichkeit lässt die eigentlichen Dramen der zunächst so beiläufig dahinfließenden Geschichte – was ist beiläufiger als „normal“ zu sein – mit leiser Wucht hervortreten. Marianne hat eine familiäre Gewaltgeschichte hinter sich; Connell bricht unter dem Erwartungsdruck zusammen und entwickelt eine depressive Störung. Nachdem eine Therapie ihm kaum helfen konnte – das Fragebogenwesen und Pillenverschreiben der einschlägigen „Beratungen“ wird sarkastisch vorgeführt –, scheint ihm literarische Begabung, eine im Mailkontakt mit Marianne erworbene Formulierungskraft, einen Ausweg zu bieten. Marianne versucht sich in kurzen sadomasochistischen Beziehungen; sie bleibt trostlos. Auch Connell empfindet den Literaturbetrieb, der ihn aufzunehmen beginnt, als hohl und schaustellerisch.
Die Unsicherheit ihrer Zukunft spiegelt sich auch in der Ungewissheit ihrer Wohnverhältnisse wider. Die Entscheidung für eine eigene küche mit elektrogeräten ist für sie nicht nur eine praktische, sondern auch eine symbolische: Sie steht für ein Stück Autonomie und die Fähigkeit, ihr Leben selbst zu gestalten.
Fazit: Das Geheimnis des Schwebezustands
So bleiben die beiden am Ende aufeinander verwiesen, zwei aus dem Nest gefallene junge Vögel. Werden sie zusammenbleiben? Nicht einmal das ist sicher. Sally Rooney hat mit „Normale Menschen“ ein Buch geschrieben, in dem alles offen bleibt. Dieses Schweben, diese Unverbindlichkeit, diese kunstvolle Verschwommenheit ist wohl das Hauptgeheimnis seines Erfolgs. Für Leser, die tiefgründige Beziehungsgeschichten mit sozialer Relevanz schätzen und die bereit sind, sich auf die Ambivalenzen junger Erwachsener einzulassen, ist dieser normale menschen roman ein absolut lesenswertes Werk. Tauchen Sie ein in die Welt von Marianne und Connell und erleben Sie eine Geschichte, die lange nachklingt.
Sally Rooney: Normale Menschen. Roman. Aus dem Englischen von Zoe Beck. Luchterhand Verlag, München 2020. 317 Seiten, 20 Euro.
