Kunstfasern, darunter auch Polyamid, aus Fleecejacken, Sportkleidung und T-Shirts lösen sich beim Waschen und gelangen in unsere Gewässer und Ökosysteme. Sind diese Mikroplastikfasern, insbesondere Polyamid Mikroplastik, gesundheitsschädlich? Und wie lässt sich die Entstehung von Mikroplastik effektiv vermeiden? Wir beleuchten die wichtigsten Fragen und geben Antworten zum Thema Fasern und ihrer Umweltwirkung. Mehr als ein Drittel des Mikroplastiks im Meer stammt aus Textilien. Die Freisetzung dieser synthetischen Fasern, zu denen auch Polyamid gehört, stellt eine wachsende Herausforderung für den Umweltschutz dar.
Was sind Kunstfasern?
Kunstfasern werden durch komplexe chemische Prozesse hergestellt und korrekterweise als “synthetische Chemiefasern” bezeichnet. Synthetische Chemiefasern, wie Polyester oder Polyamid, sind reine “Chemieprodukte”, die aus fossilen Rohstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas gewonnen werden. Polyamid ist bekannt für seine hohe Reißfestigkeit und Elastizität und wird häufig in Sportbekleidung, Strumpfwaren und Funktionskleidung eingesetzt.
Neben diesen synthetischen Chemiefasern gibt es die halbsynthetischen Chemiefasern wie Viskose. Diese werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz gewonnen und anschließend chemisch stark verändert, um sie spinnbar zu machen. Im Gegensatz dazu bestehen Naturfasern aus pflanzlichen und tierischen Fasern, die direkt zu Garnen verarbeitet werden können, ohne umfangreiche chemische Bearbeitung.
Was machen Kunstfasern in der Kleidung?
Kleidung aus Synthetikfasern bietet eine Vielzahl praktischer Vorteile: Schnell trocknende Sportbekleidung, wasserabweisende Outdoor-Jacken oder weiche und elastische T-Shirts verdanken ihre spezifischen Eigenschaften den Kunstfasern. Die Pflege gestaltet sich oft einfacher, da die Kleidungsstücke nicht verfilzen und knitterfrei bleiben. Vielfach sind im Handel auch Mischgewebe zu finden, die die positiven Eigenschaften verschiedener Fasern kombinieren. Inzwischen bestehen über die Hälfte der weltweit produzierten Textilien aus künstlich hergestellten Fasern, mit weiterhin steigender Tendenz. Dies ist nicht zuletzt dem wachsenden Kleiderkonsum und der geringeren Bereitschaft vieler Verbraucher:innen geschuldet, für qualitativ hochwertige Produkte mehr Geld auszugeben, was den Boom der Fast-Fashion-Industrie befeuert hat. In Deutschland konsumiert jede Person durchschnittlich 25 Kilogramm neue Textilien pro Jahr – ein Verbrauch, der mit natürlichen Fasern kaum zu decken wäre.
Wie wird aus den Kunstfasern Mikroplastik?
Neue Kleidungsstücke enthalten oft viele lose Fasern aus dem Herstellungsprozess, die sich besonders bei den ersten Wäschen ablösen. Aus diesem Grund entsteht bei der allerersten Wäsche die größte Menge an Mikroplastik. Beispielsweise kann eine Fleecejacke mehr als tausend Fasern pro Waschgang verlieren, wobei einige Schätzungen sogar von bis zu einer Million Fasern ausgehen, die über das Abwasser in die Umwelt gelangen können. Besonders synthetische Fasern wie Polyester und Polyamid tragen maßgeblich zu diesem Problem bei, da sie nicht biologisch abbaubar sind.
Es kommt jedoch nicht nur beim ersten Waschen zum Faserabrieb. Fasern werden im Wesentlichen durch das Schleudern in der Waschmaschine sowie durch chemische Einflüsse wie Waschmittel freigesetzt. Auch die Wassertemperatur spielt eine Rolle bei der Beschädigung des Gewebes: Je höher die Temperatur, desto stärker kann das Material beansprucht werden und mehr Fasern können sich lösen. Während sich Naturfasern und halbsynthetische Chemiefasern mit der Zeit biologisch abbauen, zersetzen sich synthetische Chemiefasern, darunter Polyamid Mikroplastik, deutlich langsamer. Insbesondere Polyester, die am häufigsten hergestellte synthetische Faser, wurde bereits in der Arktis und vielen anderen abgelegenen Orten nachgewiesen.
Weltweit sind synthetische Chemiefasern die häufigste Ursache für Mikroplastik im Meer. Das Problem bei Mikrofasern, wie sie durch Polyamid Mikroplastik entstehen, ist ihre Tendenz, Knäuel zu bilden. Diese können bei Meerestieren zu Problemen wie Verstopfungen führen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Interessanterweise entsteht laut dem Fraunhofer-Institut in Deutschland sogar noch mehr Mikroplastik durch den Reifenabrieb als durch Textilien.
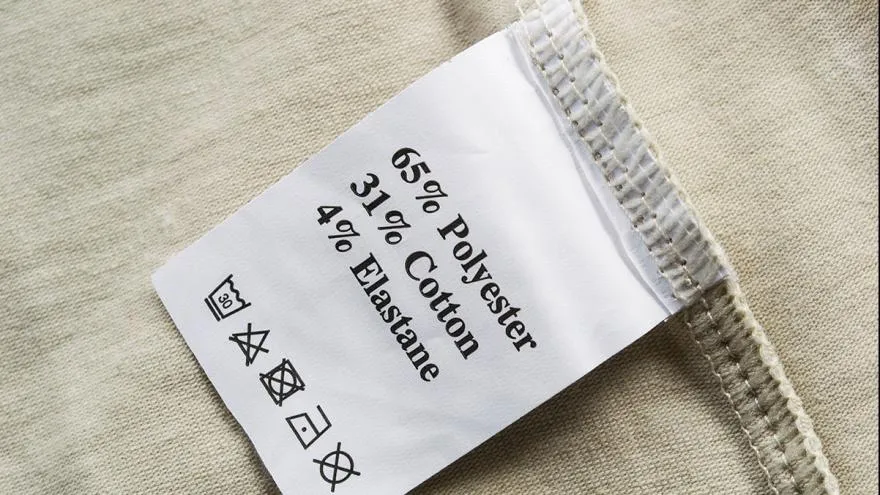 Ein Wäscheschild mit den Angaben zur Textilzusammensetzung
Ein Wäscheschild mit den Angaben zur Textilzusammensetzung
Sind Kunstfasern recycelbar?
Theoretisch ist ein Recycling der Materialien möglich, praktisch findet es allerdings kaum statt. Dies hat mehrere Gründe: Kleidungsstücke bestehen häufig aus Mischgewebe – zum Beispiel 30 Prozent Baumwolle, 65 Prozent Polyester und 5 Prozent Elasthan. Das erschwert die sortenreine Trennung der Fasern erheblich. Teilweise sind die Faserarten aufgrund fehlender Etiketten nicht mehr zu erkennen, was den Recyclingprozess zusätzlich kompliziert. Zudem erschweren Farben, Applikationen (z.B. Pailletten) und Reißverschlüsse die Wiederaufbereitung. Selbst bei sortenreinen Kleidungsstücken aus Baumwolle oder Viskose besteht das Nähgarn oft aus einem anderen Material, nicht selten aus Polyester oder Polyamid.
Ein weiteres Problem ist, dass die Fasern durch das Schreddern erheblich verkürzt werden, sodass recycelte Produkte oft von minderwertiger Qualität sind. Ein Teil der Kleidung lässt sich noch zu Putzlappen und Dämmmaterial verarbeiten. Der Großteil wird allerdings verbrannt oder auf Deponien gelagert, was wiederum Umweltbelastungen mit sich bringt. Fast die Hälfte der Textilien in der Altkleidersammlung wird zudem in ärmere Länder exportiert. Die dortigen Märkte werden damit überschwemmt und die lokale Produktion oftmals zerstört. Ein berühmt-berüchtigtes Beispiel für die Berge von Textilmüll ist die Atacama-Wüste in Chile, wo unzählige ausgediente Kleidungsstücke enden.
Woran erkenne ich Kunstfasern in der Kleidung?
Die verwendeten Faserarten müssen in Europa auf dem Kleidungsetikett angegeben werden. Die Reihenfolge der Nennung gibt dabei die prozentuale Gewichtung an. Achten Sie auf diese Bezeichnungen, um synthetische Fasern wie Polyamid zu identifizieren.
Zu den häufigsten Synthetikfasern gehören: Polyester, Polyacryl, Polyamid (bekannte Handelsnamen sind Perlon und Nylon), Polyurethan (Elastan), Polypropylen und Polyvenylchlorid (kurz: PVC). Diese Fasern sind oft für ihre Langlebigkeit und Funktionalität bekannt, tragen aber auch zur Freisetzung von Mikroplastik bei.
Zu den Halbsynthetikfasern zählen Viskose, Modal, Lyocell (Tencel), Cupro und Cellulose-Acetat. Diese Fasern werden zwar aus natürlichen Rohstoffen gewonnen, durchlaufen aber chemische Prozesse.
Naturfasern sind beispielsweise Baumwolle, Wolle, Tierhaare (z.B. Kaschmir, Alpaka), Leinen, Hanf, Jute und Seide. Diese sind biologisch abbaubar, können aber in Anbau und Verarbeitung eigene Umweltprobleme mit sich bringen.
Sollte ich auf künstliche Fasern verzichten?
Naturfasern allein können den aktuellen Bedarf an Kleidung nicht decken, geschweige denn ersetzen. Zudem sind Naturfasern nicht automatisch umweltverträglicher als synthetische Materialien. Der Anbau von Baumwolle beispielsweise verbraucht enorme Mengen an Wasser und es werden in der Regel bedenkliche Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Auch die nachfolgenden Verarbeitungsschritte können schädliche Stoffe an die Umwelt und an die oft unterbezahlten Mitarbeiter:innen abgeben. Daher reicht es leider nicht aus, einfach auf künstliche Fasern zu verzichten, um das Problem von Polyamid Mikroplastik und anderen Mikrofasern zu lösen.
Sinnvoller ist es, seinen Konsum drastisch zu reduzieren, zertifizierte Kleidung zu kaufen und sie so lange wie möglich zu benutzen. Indem wir die Lebensdauer unserer Kleidung verlängern und bewusster einkaufen, können wir einen größeren positiven Einfluss auf die Umwelt nehmen, als durch den reinen Verzicht auf synthetische Materialien. Nachhaltiger Konsum bedeutet, weniger zu kaufen, auf Qualität zu achten und die Produkte, die wir besitzen, bestmöglich zu pflegen.
 Zwei Personen mit Lebensmitteln in Einkaufsnetzen und -taschen stehen in einer Küche
Zwei Personen mit Lebensmitteln in Einkaufsnetzen und -taschen stehen in einer Küche
Sind Fleecejacken aus recycelten PET-Flaschen zu empfehlen?
Das PET-Recycling von Flaschen zu Polyesterfasern ist eine etablierte Methode, um Plastik wiederzuverwenden und sowohl den Energieverbrauch als auch den CO2-Ausstoß bei der Produktion zu verringern. Allerdings müssen PET-Flaschen häufig erst einmal in die Produktionsländer importiert werden, was den ökologischen Fußabdruck wieder erhöht. Zudem wird Altplastik teilweise auch chemisch recycelt, statt mechanisch aufbereitet zu werden. Ob dies tatsächlich umweltfreundlicher ist als die Produktion von Neuware, ist noch nicht eindeutig geklärt.
Es hat sich zudem gezeigt, dass insbesondere Fleecejacken, auch solche aus recyceltem PET, aufgrund ihrer rauen Oberfläche viele Mikroplastik-Fasern verlieren. Eine ausgediente Jacke aus recyceltem Material kann zudem nicht ohne Weiteres wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Es ist zwar grundsätzlich nicht schlecht, recycelte Fleecejacken zu kaufen, sie sollten aber seltener und mit Bedacht gewaschen werden, um die Freisetzung von Polyamid Mikroplastik und anderen Fasern zu minimieren.
Tipp: Waschen Sie Ihre Fleecejacken mit geringer Schleuderzahl und niedriger Temperatur – so verlieren sie weniger Fasern und schonen die Umwelt.
Fazit: Verantwortungsvoller Umgang mit Polyamid Mikroplastik
Polyamid Mikroplastik und andere synthetische Fasern sind eine große Herausforderung für unsere Umwelt. Das Problem ist komplex und erfordert nicht nur ein Umdenken in der Industrie, sondern auch im Konsumverhalten jedes Einzelnen. Es reicht nicht aus, einfach auf Kunstfasern zu verzichten; vielmehr geht es darum, den eigenen Textilkonsum kritisch zu hinterfragen, auf zertifizierte Produkte zu setzen und die Lebensdauer unserer Kleidung zu maximieren. Jedes Mal, wenn wir Kleidung waschen oder tragen, können sich Mikrofasern lösen. Durch bewusste Kaufentscheidungen und eine angepasste Pflege können wir alle dazu beitragen, die Belastung unserer Ökosysteme durch Mikroplastik zu reduzieren. Informieren Sie sich weiter und werden Sie aktiv, um Plastik zu sparen und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.
