Jakob von Uexküll (1864-1944), ein deutschbaltischer Biologe und Philosoph, revolutionierte unser Verständnis der Beziehung zwischen Lebewesen und ihrer Umgebung. Seine zentrale These: Jedes Lebewesen bewohnt eine eigene, subjektive Welt, die er als “Umwelt” bezeichnete. Diese Umwelt von Uexküll ist nicht einfach die objektive Umgebung, sondern vielmehr eine durch die spezifischen Sinnesorgane, Verhaltensweisen und physiologischen Eigenschaften des jeweiligen Lebewesens konstruierte Realität.
Uexkülls Konzept der Umwelt hat weitreichende Implikationen, die bis heute Wissenschaftler und Philosophen herausfordern und zu intensiven Debatten anregen. Es stellt die Frage nach der Objektivität unserer Wahrnehmung und unserer Rolle in der Welt neu.
Uexkülls Ideen sind in dreifacher Hinsicht provokativ:
- Er postuliert für jedes Lebewesen eine Erfahrungswelt, die der wissenschaftlichen Erkenntnis grundsätzlich entzogen ist. Dies widerspricht dem weitverbreiteten Glauben an die Allmacht der Wissenschaft.
- Keine dieser Umwelten hat einen höheren metaphysischen Status als die anderen. Auch wir Menschen, einschliesslich der Wissenschaftler, sind Lebewesen, und unsere Erfahrung und unser Studium der Welt gewährt uns keinen privilegierten Zugang zu einer objektiven Wahrheit.
- Die Behauptung, dass jeder Mensch eine eigene, private phänomenale Welt erlebt und niemals Zugang zur Umwelt eines anderen hat, hat viele Denker zutiefst beunruhigt.
Die philosophische Rezeption von Uexkülls Ideen, besonders in Frankreich und Deutschland, hat verschiedene Strategien entwickelt, um sich gegen diese Ansicht und die daraus befürchteten sozialen und moralischen Implikationen zu wehren. Bisher konnte aber keine dieser Provokationen wirklich zufriedenstellend gelöst werden. Vielleicht erklärt das Fortbestehen dieser beunruhigenden Fragen das anhaltende wissenschaftliche Interesse an Uexkülls Gedanken.
Uexküll, ursprünglich ein Anhänger eines mechanistischen Weltbildes, wandte sich im Laufe seiner Forschung zunehmend von dieser Vorstellung ab. Beeinflusst von Denkern wie Hans Driesch, der die Nicht-Maschinelle Natur von Lebewesen betonte, entwickelte Uexküll seine eigene, einzigartige Sichtweise. Er argumentierte, dass jedes Lebewesen ein Subjekt und ein Akteur ist, das seine eigene, phänomenale Welt bewohnt – seine Umwelt. Diese Umwelt entsteht durch die körperlichen Prozesse und Interaktionen des Lebewesens mit seiner Umgebung. Die Komplexität und Vielschichtigkeit von Uexkülls Werk, sowie die unterschiedlichen Verwendungen des Begriffs Umwelt, machen die Interpretation seiner Schriften bis heute zu einer Herausforderung.
Uexküll selbst bezeichnete seine Ideen als “Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung”. Diese Beschreibung ist treffend, da Uexküll zwar über eine rein wissenschaftliche Darstellung hinausgeht, aber aufgrund seiner mangelnden philosophischen Ausbildung und Strenge kein echtes philosophisches System entwickelt. Die Schwierigkeiten beim Lesen von Uexküll rühren von einer entscheidenden Unterscheidung zwischen zwei Perspektiven her: einer Sicht “von aussen”, aus der Wissenschaftler beobachten und messen, Hypothesen aufstellen und testen, und einer Sicht “von innen”, der subjektiven Erfahrung jedes Lebewesens, die sein Leben aus seiner eigenen Perspektive ausmacht und den Horizont seiner Welt eröffnet. Für Uexküll erlaubt die erstere Sichtweise, wie sie beispielsweise von Physikern vertreten wird, nur die Existenz einer einzigen Welt. Aus der letzteren Sicht gibt es so viele Welten, wie es lebende Subjekte gibt. Obwohl dieser Punkt für Uexkülls Denken von zentraler Bedeutung ist, macht er nicht immer deutlich, welche Sichtweise er gerade einnimmt. Entscheidend ist, dass der Begriff Umwelt in beiden Diskursarten verwendet wird, aber je nach Kontext sehr unterschiedlich funktioniert.
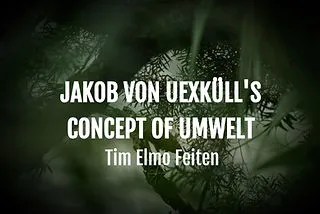 Tick sitting on the tip of a branch
Tick sitting on the tip of a branch
Durch seine wissenschaftlichen Studien entwickelte Uexküll eine bahnbrechende Methode, um tierisches Verhalten in Form von Zeichenprozessen zu verstehen. Er unterschied zwischen der Umwelt eines Tieres, wie sie der Forscher wahrnimmt, und der Menge von Faktoren, die für das Tier selbst relevant und wahrnehmbar sind. Wenn diese Faktoren den sensorischen Apparat des Tieres stimulieren, werden sie durch das Nervensystem (falls das Tier eines hat) in Zeichen umgewandelt. Einfache Zeichen für Ort, Position und andere Eigenschaften werden zu komplexeren Objektzeichen synthetisiert und nach aussen verlagert, um die Umwelt des Tieres zu bilden. Auf diese Weise erzeugt der Prozess, der zur subjektiven Erfahrung führt, sowohl die wahrgenommenen Objekte als auch den Raum, in dem sie angetroffen werden. Für Uexküll besteht diese Umwelt sowohl aus Wahrnehmungs- als auch aus Handlungszeichen, was bedeutet, dass Objekte direkt als bestimmte Handlungen für das Subjekt ermöglichen wahrgenommen werden. Dieser Einblick beeinflusste zunächst die Gestaltpsychologie und wurde später unter dem Namen Environmental “Affordances” zum zentralen Bestandteil der ökologischen Psychologie. Uexkülls Ansatz, biologische Phänomene als Zeichenprozesse zu interpretieren, sollte später gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Geburt der Biosemiotik als eigenständiges Feld inspirieren.
Aus der Perspektive des Tieres besteht die Umwelt jedoch nicht aus Zeichen, sondern aus Objekten, Ereignissen usw. Ich nehme eine Blume wahr, nicht das Zeichen einer Blume. Aus dieser Sicht beschreibt Umwelt einen Strom bewusster Erfahrung, einen “Reality Tunnel”, das Rohmaterial für eine phänomenologische Untersuchung. Da wir aber Erfahrung haben müssen, um sie zu untersuchen – anstatt ihre Verhaltenskorrelate zu untersuchen – müssen unsere Darstellungen der phänomenalen Umwelten anderer Tiere immer über das rigorose Studium hinaus in den Bereich der Spekulation übergehen. Genau das tut Uexküll, wenn er seine dichterische Fantasie in die Beschreibung der Umwelten von Bienen, Zecken, Vögeln und anderen Tieren einsetzt. Unsere Wissenschaft gibt uns Hinweise auf die Struktur, die diese Welten wahrscheinlich aufweisen werden, aber wir können sie niemals selbst erfahren.
Das Konzept der Umwelt erfüllt somit eine doppelte Funktion in zwei unterschiedlichen Projekten – einerseits die streng empirische Untersuchung von tierischem Verhalten und Physiologie, andererseits eine spekulative und kreative Art, sich Welten vorzustellen, die sich radikal von unseren unterscheiden. Zwei der häufigsten Meinungsverschiedenheiten, die sich daraus ergeben, sind: Ist Umwelt eine Konstruktion oder eine Selektion? Beim Studium des Verhaltens ist es sinnvoll, von Umwelt als einer Menge von Merkmalen zu sprechen, die durch die physiologischen Fähigkeiten zur Empfindung und Handlung einer bestimmten Spezies aus einer Umgebung ausgewählt wird. Wenn man sich aber nach subjektiver Erfahrung erkundigt, macht das keinen Sinn, da nur Individuen Erfahrung haben (zumindest nach Uexkülls Theorie) und Erfahrung nicht einfach in der physischen Welt herumliegen und “ausgewählt” werden kann. Stattdessen ist Uexkülls Darstellung konstruktivistisch, in einer Weise, die explizit nach Kant modelliert ist. Uexküll betrachtete es als seine Aufgabe, Kants Darstellung der Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung in zwei Richtungen zu erweitern: 1) die Rolle, die der Körper spielt, und 2) die Subjektivität nichtmenschlicher Tiere. Die Methodik ist jedoch nicht kantisch. Anstelle einer reinen Form der Sensibilität schliesst Uexküll, dass unsere Erfahrung von Raum durch die drei halbrunden Kanäle ermöglicht wird, die ungefähr orthogonal zueinander in unserem Innenohr angeordnet sind. Diese Kanäle ermöglichen es uns, die Bewegungen unseres Kopfes zu spüren, was es uns wiederum ermöglicht, die dreidimensionalen Räume unserer Umwelten zu erleben.
Uexküll entwickelte ausserdem eine ganzheitliche Sicht der Natur als eine sinnvolle Gesamtheit, die stark von Goethe beeinflusst war. Da er Darwins Darstellung der Artenveränderung und Anpassung ablehnte, benötigte Uexküll eine alternative Erklärung dafür, warum die Teile der Natur so perfekt zusammenzupassen scheinen. Basierend auf einer musikalischen Metapher entwickelte er eine Vision der Natur als ein grosses, sinnvolles Ganzes, das aus Melodien, Harmonien und Kontrapunkten zwischen den Morphologien und Verhaltensweisen von beispielsweise Raubtier und Beute besteht. Diese Sichtweise hat deutliche Obertöne von Romantik, Organismus und sogar Pantheismus. Uexküll selbst dehnte seine ganzheitlichen Verpflichtungen und die Ablehnung von Veränderungen, die in seiner Anti-Evolutionshaltung impliziert sind, zu einer zutiefst totalitären, organischen politischen Theorie aus. Dies erzeugt einen scharfen Kontrast: Einerseits scheint das Konzept der Umwelt unsere Sicht auf die Welt, die wir bewohnen, zu erschüttern und uns eine nicht-anthropozentrische Vielfalt von Welten anstelle einer einzigen, objektiven, wissenschaftlichen Darstellung der Welt zu geben; andererseits drückt Uexkülls Darstellung des Staates als Organismus, die er im Aufstieg der NSDAP zur Macht bestätigt und verwirklicht sah, eine zutiefst reaktionäre und repressive Vision aus, in der jedes Individuum dem Ganzen des totalitären Staates vollständig untergeordnet ist. Es ist wichtig zu bedenken, dass Staaten nicht buchstäblich Organismen sind, daher ist Uexkülls Verwendung seiner biologischen Ansichten zur Entwicklung einer Darstellung des Staates nicht nur politisch, sondern auch intellektuell problematisch. Der Vergleich von Gesellschaften und Staaten mit Organismen ist eine gängige reaktionäre Trope, die mindestens bis zum römischen Konsul Agrippa Menenius Lanatus zurückreicht. Wenn wir den Vergleich ablehnen, hat Uexkülls Darstellung der Natur keine direkte Relevanz für das politische Denken.
Die offene Frage für uns heute ist, wie genau wir Uexküll lesen wollen und was wir aus seinem Werk herausholen können. Einige Kommentatoren loben das Potenzial seines Denkens, Debatten über die Natur von Leben und Geist neu zu beleben, während andere vor seinen Gefahren warnen, weil sie Uexkülls totalitäre Politik als integralen und untrennbaren Aspekt seines gesamten Œuvres betrachten. Was diese unterschiedlichen Lesarten von Uexkülls Werk gemeinsam haben, ist, dass sie unvollendete, fortlaufende Projekte sind. Seltsamerweise scheint die Rezeption seines Werkes, obwohl sein Denken in verschiedene Richtungen entwickelt wurde, viele neue Fragen, aber nur sehr wenige Antworten hervorgebracht zu haben.
Die historische Rezeption in der Philosophie hat sich darauf konzentriert, seine Behauptung zu widerlegen, dass die Umwelten des Menschen individuell und geschlossen sind. In der Wissenschaft hat sich die Rezeption seiner Ideen darauf konzentriert, bestimmte Teile seines Denkens zu isolieren, die für das Studium des tierischen Verhaltens nützlich sind. So war beispielsweise Uexkülls Einfluss auf Konrad Lorenz und andere wichtig für die Entstehung der Ethologie als Teildisziplin der Biologie. Sowohl in der philosophischen als auch in der wissenschaftlichen Rezeption seines Werkes bestehen jedoch ungelöste Fragen.
Die philosophische Rezeption von Uexküll sowohl in Frankreich als auch in Deutschland erfolgte weitgehend durch die Übernahme anderer Konzepte und Ausgangsannahmen als Uexküll selbst. Dies ermöglichte es ihnen, seine Schlussfolgerung zu vermeiden, dass Menschen, wie alle Tiere, jeweils in einer isolierten privaten Welt subjektiver Erfahrung leben, verhinderte aber auch, dass sie Uexküll direkt mit seinen eigenen Bedingungen konfrontierten. In der wissenschaftlichen Rezeption, insbesondere in der neueren Arbeit in der Kognitionswissenschaft, wird Uexküll oft nur beiläufig erwähnt. Da ein tiefes Engagement mit seinem Denken weitgehend fehlt, läuft die Rezeption von Uexküll in diesen Kontexten Gefahr, die wichtigsten philosophischen Implikationen seines Werkes zu übersehen. Trotz eines Jahrhunderts Arbeit an Uexküll sind wir heute immer noch sehr mit dem Prozess beschäftigt, herauszufinden, was genau sein Konzept der Umwelt beinhaltet, wie es mit unseren verschiedenen epistemischen Projekten resoniert und kollidiert und was es in Zukunft für uns tun könnte.
Abschliessend lässt sich sagen, dass Uexkülls Konzept der Umwelt eine revolutionäre Idee ist, die unser Verständnis der Welt und unserer Beziehung zu ihr grundlegend verändert hat. Seine Erkenntnisse sind bis heute relevant und inspirieren Wissenschaftler, Philosophen und Künstler zu neuen Denkansätzen. Wir laden Sie ein, sich auf die faszinierende Reise der Umwelt von Uexküll einzulassen und die Welt mit neuen Augen zu sehen.
